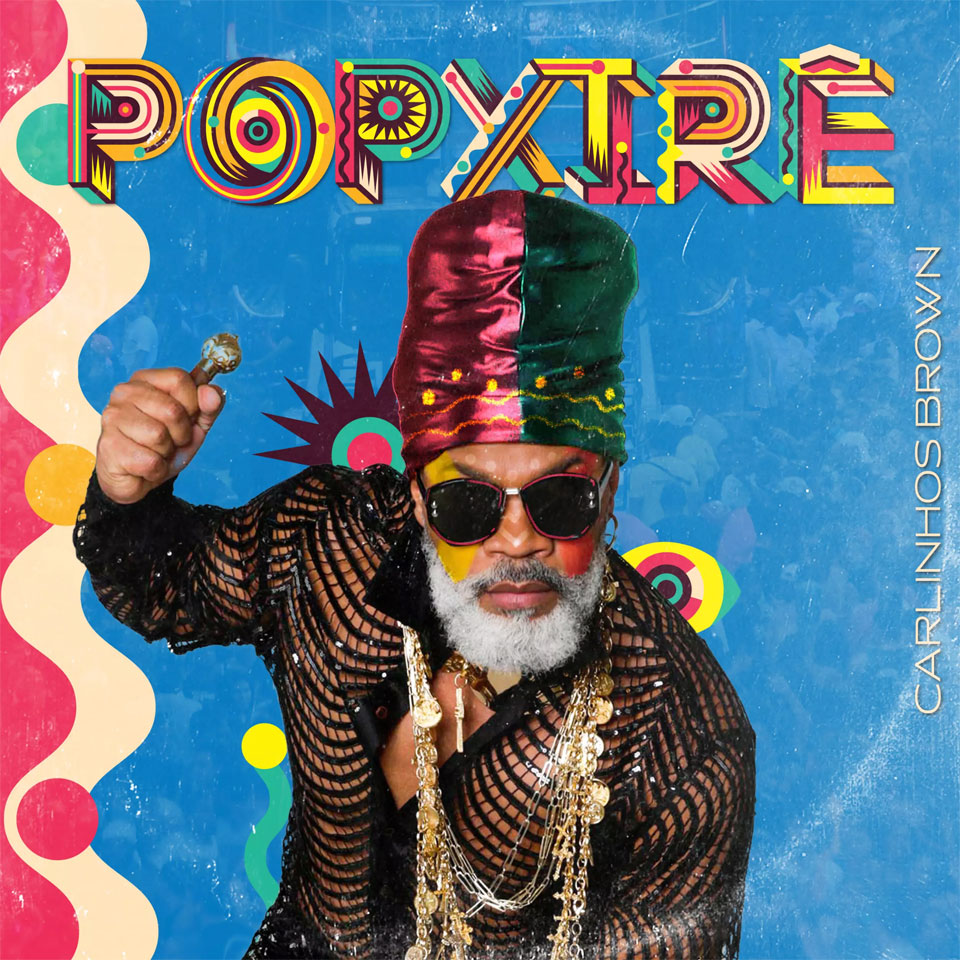Zum zweiten Mal hintereinander dominieren in der Kolumne diesmal die Damen und das vielleicht nicht von ungefähr. Es gibt gerade im Einwanderungsland Deutschland zunehmend Sängerinnen lateinamerikanischer Musik, die durch ihre Lebensgeschichte eine ungeheure Vielfalt kultureller Erfahrungen und Einflüsse haben, daher auch in mehreren Sprachen singen und dies zu ihrem Konzept machen. Da ist zunächst mal:
Rosa Morena Russa – „Trick-Trague“
 Da Casa Records, Galileo MC
Da Casa Records, Galileo MC
Deutschland, Russland / MPB-Crossover
Wem Russas Bossa Novas und Sambas merkwürdig vorkommen: Russa singt russisch, jiddisch, deutsch und englisch. Warum sollte die russische Jüdin auch nicht in den Sprachen singen, die sie am besten beherrscht? Zudem lebt sie in Hamburg, wo sie Kontakt zur Jazzszene hat und sie war auch einige Zeit in Brasilien. Unabhängig von der sprachlichen Exotik: Russa präsentiert gelungene Kompositionen mit tollen jazzigen Improvisationen ihrer Begleitmusiker, von denen insbesondere Posaunist Dan Gottshall hervorzuheben ist, der ein wenig an Brasiliens Raul de Souza erinnert. Kateryna Ostrovska, wie Russa mit bürgerlichem Namen heißt, baut auch mal einen Reggae ein, die Balladen sind ihr diesmal aber besonders gut gelungen. Bemerkenswert ist ihr Stück „Aquis Sanctis No. 2 – Yoyne Hanuvi Ijexá“. Jiddische Musik, die in afro-brasilianische Ritualmusik übergeht. Eine abenteuerliche Kombination, aber so entwickelt sich im Prinzip Musik weiter.
Judith Tellado – „Yerba Mala“
 Timezone
Timezone
Deutschland, Puerto Rico / Latin, Karibik, Jazz, Americana
Ein nicht unähnliches Konzept hat die ebenfalls bei Hamburg lebende, puerto-ricanische Sängerin Judith Tellado. In verblüffender Vielfalt zeigt sie, was sie so alles kann und mag: Bolero, Jazzstandards, Latinfolk, Salsa, R’n’B, amerikanische Hymnen, Pop- und Soulballaden, manches könnte auch einem Musical entstammen. Ähnlich wechselt sie die Sprachen: Spanisch, Englisch, Deutsch. Die Songs sind oft ungewöhnlich, haben aber eine eindringliche Melodik, die vom intensiven Gesang passend vermittelt wird. So etwas gilt heute eigentlich als nicht marktkonform, gar profillos. Aber wenn jemand seine Interessenvielfalt derart deutlich offeriert, zeigt er nicht gerade dann Profil? In den Sechzigern ermöglichten musikalische Vielseitigkeit und sprachliche Begabung Sängerinnen wie Nana Mouskouri eine weltweite Karriere. Schön, dass dies wiederzukommen scheint. Man braucht Stimmen gegen den Einheitsbrei. Für Latin-Fans ist aber genug dabei. Ihr Song „Guyaba“ beispielsweise hat das Zeug großer lateinamerikanischer Balladen und wird von flirrendem Querflötenspiel umschmeichelt.
Anastácia & Zé Eugênio – „Cheiro e Prosa“
 Eigenverlag, anast.azevedo@googlemail.com
Eigenverlag, anast.azevedo@googlemail.com
Brasilien, Deutschland / MPB
Nach langer Zeit ist mal wieder was von der in Berlin lebenden brasilianischen Sängerin Anastácia Azevedo zu hören. Sie hat sich mit ihrem Kollegen Zé Eugênio zu einem Duo zusammengetan und damit auch ein neues Klangprofil erzeugt. Die Rhythmik des Nordostens Brasiliens, die ihre ersten beiden Alben prägte, ist etwas zugunsten einer sphärischen und sehnsuchtsvolleren Klangästhetik gewichen. Elektronische Sounds spielen eine größere Rolle und Zé Eugênio bringt andere Aspekte ein. Musikalisch bewegt sich das Album zwischen modernem Bossa Nova, Samba, Maracatu, Côco, mit jazzigen Improvisationen und auch mal einem Funk-Touch. Azevedos Gesang ist intensiv voller Melodien, die einen berühren. Ein schwebender Grundton begleitet das Album. In „Me Leve“ wagt Zé Eugênio auch mal leichte Experimente mit Sprechgesang und etwas düsterer Elektronik. Manchmal erinnert der Sound an Ivan Lins. Soweit man Anastácia Azevedos bisherige Veröffentlichungen kennt, ist dieses Album ein großer Sprung nach vorne.
Angélique Kidjo – „Celia“
 Verve, Decca France, Universal
Verve, Decca France, Universal
Afro-kubanischer Salsa
Und noch mal Sängerin und noch mal Crossover. Die aus dem westafrikanischen Benin stammende Sängerin Angélique Kidjo hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Verbindung von nord-, mittel- und südamerikanischer Musik sowie der Pop- und Rockmusik mit der afrikanischen Musik zu verdeutlichen. Dabei interpretiert sie oft bekannte Stücke, die aber weniger den Anschein eines Covers als einer afrikanisierten Version hinterlassen. Zuletzt zeigte sie dies mit einem Album mit Musik der Talking Heads, deren Verwurzelung in afrikanischer Rhythmik dabei überdeutlich wurde. Auch bei Kidjos Verneigung vor der großen, 2003 verstorbenen, kubanischen Salsa-Sängerin Celia Cruz ist dies nicht anders. Kubanische Musik, die sich aus afrikanischen Stilen während der Sklaverei entwickelt hatte, war besonders in den 60ern in Afrika sehr populär. Kidjo wuchs mit dieser Musik auf und hat Celia Cruz später auch noch live erlebt. Beide verbindet zudem die Flucht aus ihren Heimatländern vor kommunistischen Regimen. Die Arrangements des aus Martinique stammenden David Donatien für Kidjos Album haben eine im Vergleich zur Salsamusik eher federnde Rhythmik. Die Bläser wirken dezenter und tiefer. Die kubanische Rhythmik wird weitgehend zugunsten afrikanischer Beats zwischen Souskous und Afro Beat über Bord geworfen. Dadurch wirken die Stücke flüssiger und eleganter, weniger auf Dramatik gebaut. Auch eine Ballade aus dem Repertoire Celia Cruz‘ wie „Sahara“ bekommt Kidjo gut hin, der sie ein arabisches Flair verleiht. Außerdem imitiert Kidjo Celia nicht, sondern behält immer ihre eigene Intonation bei. Die Verbindung kubanischer mit afrikanischer Musik ist insbesondere in dem von der Rhythmik der Santeria-Religion geprägten Stück „Yemaya“ zu spüren. Für den afrikanischen Grundton sorgt zudem die nigerianische Afro Beat-Legende Tony Allen. Weitere Gäste sind die Bassistin Meshell Ndegeocello, die britische Jazzformation Sons of Kemet und die Gangbe Brass Band. Ein starkes Album, das die musikalischen Grenzen der Kontinente verwischen lässt.
Combo Chimbita – „Ahomale“
 Anti-, Indigo
Anti-, Indigo
Kolumbien, USA / Psychedelic Tropical Music
Auch bei der kolumbianischen Band Combo Chimbita dominiert eine Sängerin und die Gruppe ist sogar ein Musterbeispiel an Culture Clash. Ihr hochexplosives Gebräu führt uns vor, was es in Lateinamerika meist abseits unserer Wahrnehmung für kreative, skurrile und wilde Musik gibt. Dazu muss man den Kopf schütteln, entweder vor Verblüffung oder weil man mitgerissen wird von den psychedelischen Sounds, in denen sich mystischer Anden Folk, Cumbia-Rhythmen, wimmernde Elektronik, krachiger Garage Rock, Dub-Elemente, aber auch afrikanische Souskous-Gitarren verbinden. Sängerin Carolina Oliversos beseelte Gesänge in den Echokammern wirken zudem wie ein klanglicher Tsunami. Sie versteht sich als Schamanin, die Botschaften ihrer Urväter aus der Vergangenheit hervorholt. Entsprechend zieht die Band alle Register zwischen überirdischen Frauenchören, punkigem Krach und verfremdeten Geisterstimmen. Dies ist kein Worldbeat Clubmusic Projekt, sondern eine futuristische Tropical Band, die den Begriff der Tropical Music um einiges an stilistischen Grenzüberschreitungen erweitert. Derart verrückte Gruppen gab es schon in den 70ern, gerade in der Chicha-Musik, als elektrifizierte Instrumente in Lateinamerika der neueste Hit wurden, kein Musiker dabei hinten anstehen wollte und man wild alles Mögliche zwischen Tradition und Rock ausprobierte. Das war damals cool, manches davon ringt einem heute zwar ein Lächeln ab, aber dieses Überbordende jener Zeit spürt man auch bei dieser feurigen Truppe. Sie ist zudem in Brooklyn beheimatet, wo sie ihre Traditionen jederzeit mit den Inspirationen des New Yorker Melting Pot versehen dürfte. Inzwischen gibt es gerade in der neueren Cumbia-Szene etliche ähnliche Bands, die lateinamerikanische Musik mit elektronischen Retrosounds, verrückter Kostümierung und schrillen Auftritten neu definieren. Eine ungestüme Szene, die in etwa das Gegenteil dessen darstellt, was einem hierzulande aus dem Autoradio entgegenblökt. Die klanglichen Abenteurer der Combo Chimbita haben etwas Dadaistisches, was heute mehr denn je gut tut.
Roberto Santamaria – „Cuban Soul Train“
 Connector Records, In-akustik
Connector Records, In-akustik
Kuba / Soul-Salsa-Crossover
Wer das Cover von Roberto Santamarias Album sieht, wird sich schnell fragen: Was ist denn das für eine heiße Scheiße? Voll Retro oder was? Santamaria verneigt sich mit Afromob und psychedelischem Bühnenanzug vor einem seiner größten Einflüsse, der amerikanischen Soul Music-TV-Show „Soul Train“, die in den 70ern auf Kuba gut zu empfangen war und dort scheinbar ähnliche Verzückung unter den Jugendlichen auslöste wie in der DDR der heimlich geschaute Beat Club. Mit kubanisch arrangierten Versionen von Hits von James Brown bis Barry White wäre Santamaria damals aber wohl auf Kuba als Vaterlandsverräter bezeichnet worden. Um keine falschen Erwartungen zu wecken, sollte man aber sagen, dass Santamaria nicht etwa Soul-Hit-Covers mit kubanischer Perkussion spielt, sondern Soul-Klassiker wie auch kubanische Kompositionen mit Soul-Touch. Gegenüber der traditionellen Soul Music sind hier ein ganz anderes Tempo und ein anderer Ausdruck bestimmend. Wer das Original zu sehr im Ohr hat, für den ist es manchmal gewöhnungsbedürftig, was insbesondere auf Otis Reddings „Dock Of The Bay“ zutrifft. Hier hat er den Geist des Stückes nicht erfasst, das Flair ist weg, denn Santamarias Stimme hat auch nicht die Typik, das Heisere, das Animalische der Soulsänger. Trotzdem ist das eine durchaus unterhaltsame Sache und Santamaria bemüht sich um eine eigene Herangehensweise. So lässt er bei einem Bob Marley-Stück den Reggae gleich ganz weg und macht was Neues draus. Am besten wirkt sein kubanischer Soul aber, wenn er sich nicht an bekannten Originalen versucht, sondern authentische kubanische Musik mit einem Schuss Soul spielt. Aber auch wenn der Soul musikalisch dominiert wie bei „Shake Your Booty“ von K. C. & The Sunshine Band passen Rhythmus und Gesangsstil zusammen. So hätte die amerikanische Funk- und Soul-Band damals mit ihrem Hit vielleicht in einer kubanischer Abmischung geklungen. Pluspunkte gibt es auf jeden Fall für den arg trippigen Retroanzug.
Marcos Valle – „Sempre“
 Far Out Recordings
Far Out Recordings
Brasilien / Brazil Funk, Smooth Jazz
Zehn Jahre ist es her, dass Marcos Valle, einer der bekanntesten Musiker der zweiten Bossa Nova-Generation, ein Studio-Album veröffentlicht hat. Das Londoner Far Out-Label hatte ihn vor Jahren aus der Versenkung geholt, auch weil er einer der Vorbilder des Sound-Konzepts des Labels ist. Entsprechend preist man „Sempre“ als „feel-good Brazilian party music, ecstatic disco, cosmic samba, and late-night jazz-funk“ an, erwähnt aber auch, dass er damit sehr an seine Veröffentlichungen aus den frühen Siebzigern anknüpft. Und das ist auch das Merkwürdige an dieser Scheibe. Es wirkt, als wäre Valle um ein neues Album gebeten worden und hätte dazu mal seine Outtakes von vor gut 45 Jahren gesichtet. Das Klangbild wirkt irgendwie retro, es gibt viel spacige Sounds besonders zu Beginn der Stücke, aber vor allem jede Menge Synthesizer statt Keyboards, einfache Akkordwechsel im Übermaß, Stringsounds und programmierte Rhythmen im Midtempo. Das meiste ist tanzbar, aber schwitzen muss man dabei nicht. Noch am flottesten wirken die Tracks mit Bläsern und mit Valles Gesang. Das alles passt eher in die Richtung Smooth Jazz denn Brasilien und manches klingt gar nach austauschbarer Übergangsmusik zwischen zwei Radiosendungen. Live ist der Meister ja nach wie vor energetisch und sehenswert, aber in letzter Zeit wirken die Produktionen des Far Out-Labels seltsam uninspiriert. Auch „Sempre“ gibt sich mehr als Fingerübung denn als ausgereiftes Album. Azymuth-Bassist Alex Malheiros mischt hier übrigens auch noch mit. Insgesamt wirkt Valles Rückbesinnung leider zumeist etwas belanglos und angestaubt.